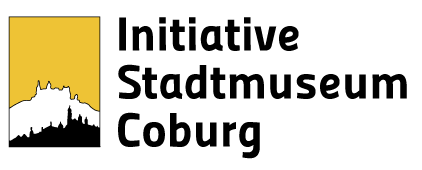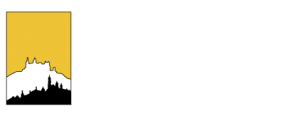LATEINISCHE WEIH- UND BAUINSCHRIFTEN
Latein bei Bauinschriften ist bei Kirchen, Schulen etc. zu erwarten, denn Latein als Sprache der Gebildeten und des Klerus hier natürlich verwendet.
Begriff „WEIH- UND BAUINSCHRIFTEN“
Als WEIH- UND BAUINSCHRIFTEN war im Altertum die in dichterischer Form abgefasste Inschrift auf dem öffentlichen Bauwerken wie den Triumphbögen, Tempeln oder Stadttoren wie in Regensburg gemeint (vgl. xc).
In Coburg vor allem lateinische Bauinschriften an Schulen (Casimirianum, Ratsschule), öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Georgenspital, Veste), Kirchen (Salvatorkirche) zu finden.
In unserem Zusammenhang wird als eine
bezeichnet. Sie können künstlerisch aufwändig gestaltet sein und befinden sich meist an einer exponierten Stelle.
Entstehung in der Antike
Das Epitaph entwickelte sich u. a. während des Spätmittelalters vor allem in großen Kirchen aus aufwändig gestalteten Grabplatten, die immer häufiger an Wänden und Pfeilern und getrennt von der Grabstelle aufgestellt bzw. gehängt worden sind.
Formen von Bauinschriften
In seiner einfachsten Form ist ein Epitaph eine mit Namen und meistens mit Lebensdaten beschriftete Tafel.
Im 16. und 17. Jahrhundert führte das wachsende Repräsentationsbedürfnis des städtischen Bürgertums und des Adels zu einer schnellen und weiten Verbreitung und Weiterentwicklung
Besonders seit Einführung der Reformation kam es zu Umarbeitungen und Sekundärnutzungen von
Im Barock wurde das formale Muster der Bauinschriften zu einer Gestaltungsmöglichkeit, um
Barocke Bauinschriften sind meist architektonisch aufgebaut und plastisch aus Stein, Metall oder Holz gearbeitet, in der Regel farbig gefasst und oft teilvergoldet.
Insbesondere werden hier kirchliche Bauinschriften gezeigt:
an der Morizkirche
Salvatorkirche
in der Hofkirche
Verwendete bzw. weiterführende Seiten zum Thema:
Armin Leistner: Alte Grabdenkmäler und Epitaphien des Coburger Landes – II. Teil; in: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 1977; S. 95 ff.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausinschrift
https://www.rdklabor.de/wiki/Bauinschrift
Zuschriften bitte an: Coquus22@gmail.com (Administrator)
Bitte besuchen Sie auch die gleichlautende Seite bei Facebook: Coburgum Latinum
zurück zur Prima Pagina